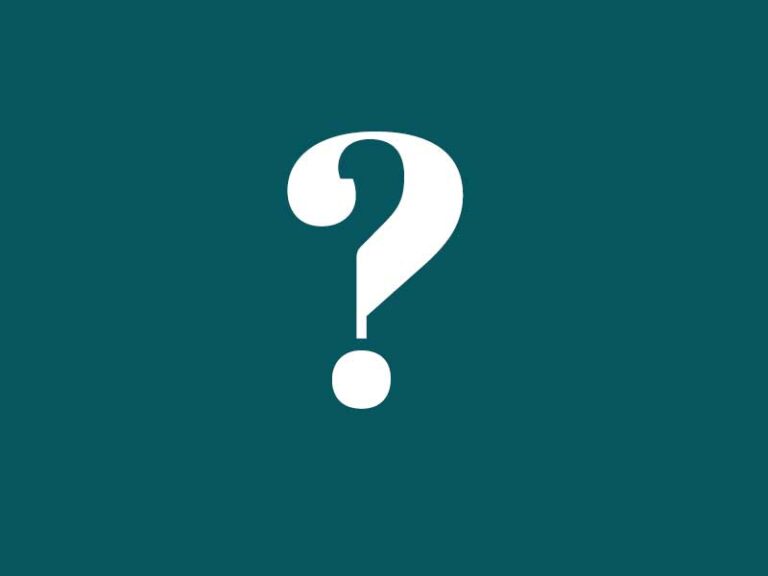Open-House-Verfahren
Ein Open-House-Verfahren ist ein Vergabeverfahren, das insbesondere im öffentlichen Beschaffungswesen oder bei der Vergabe von Verträgen im Gesundheitswesen (z. B. Rabattverträge mit Krankenkassen) eingesetzt wird. Es unterscheidet sich deutlich von klassischen Ausschreibungen.
Merkmale des Open-House-Verfahrens:
Nicht diskriminierend und offen
Jeder Anbieter, der die vorgegebenen Bedingungen erfüllt, kann dem Vertrag zu denselben Konditionen beitreten.
Keine Auswahlentscheidung
Es findet kein Wettbewerb im eigentlichen Sinn statt – es gibt keine Bewertung von Angeboten und keinen Zuschlag an nur einen Bieter.
Veröffentlichung eines Beitrittsangebots
Die Vergabestelle (z. B. eine Krankenkasse) veröffentlicht ein Angebot zum Vertragsbeitritt mit definierten Konditionen (z. B. Preise, Laufzeit etc.).
Laufende Beitrittsmöglichkeit (innerhalb eines Zeitraums)
Anbieter können innerhalb einer festgelegten Frist dem Vertrag beitreten, solange sie die Bedingungen akzeptieren.
Anwendungsbeispiel
Rabattverträge zwischen Krankenkassen und Pharmaunternehmen
Eine Krankenkasse möchte Rabattverträge für ein bestimmtes Medikament abschließen. Statt eine exklusive Ausschreibung zu machen, startet sie ein Open-House-Verfahren. Jeder pharmazeutische Hersteller, der das Medikament anbietet und bereit ist, den festgelegten Rabatt zu gewähren, kann dem Vertrag beitreten – ohne Wettbewerb, solange er die Bedingungen erfüllt.
Vorteile
- schnell und unbürokratisch
- geringe Verwaltungskosten
- vermeidet Monopole (mehrere Anbieter gleichzeitig möglich)
Nachteile
- kein Preiswettbewerb
- kann weniger wirtschaftlich sein als klassische Ausschreibungen
- in der Vergangenheit rechtlich umstritten (es gab Entscheidungen des EuGH dazu)
Gern – das Open-House-Verfahren bei der Beschaffung von Corona-Masken war ein prominenter und politisch brisanter Anwendungsfall in Deutschland.
Hintergrund: Corona-Pandemie & Maskenmangel
Zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 herrschte weltweit ein Mangel an medizinischen Schutzmasken (insbesondere FFP2- und OP-Masken). Die Bundesregierung – konkret das Bundesgesundheitsministerium (BMG) unter Minister Jens Spahn – musste schnell große Mengen an Schutzausrüstung beschaffen.
Das Open-House-Verfahren des BMG
Im März 2020 startete das BMG ein Open-House-Verfahren zur Maskenbeschaffung. Ziel war es, möglichst viele Anbieter gleichzeitig zu gewinnen – unabhängig von Größe oder Bekanntheit.
Wichtige Merkmale
- Jeder Anbieter konnte einheitlichen Rahmenbedingungen beitreten, z. B.:
- Preis: 4,50 € pro FFP2-Maske, 0,60 € pro OP-Maske
- Mindestmenge
- Lieferfrist
- Es wurde kein Wettbewerb unter den Anbietern durchgeführt.
- Lieferverträge wurden automatisch geschlossen, sobald ein Anbieter sich zum festgelegten Preis bereit erklärte zu liefern.
Probleme & Kritik
Das Verfahren führte zu erheblichen Rechtsproblemen und Skandalen:
Lieferausfälle: Viele Anbieter konnten die versprochene Menge oder Qualität nicht liefern.
Zahlungsverzögerungen: Das Ministerium zahlte nicht alle Rechnungen, wenn Masken mangelhaft waren oder Lieferfristen nicht eingehalten wurden.
Massenhafte Klagen: Über 100 Lieferanten verklagten das Ministerium auf Zahlung, viele davon erfolgreich.
Vergaberechtliche Kritik:
- Es gab rechtliche Bedenken, ob das Verfahren wirklich EU-vergaberechtskonform war.
- Der Bundesrechnungshof kritisierte das Vorgehen als „nicht wirtschaftlich“.
Politische Skandale: In einigen Fällen geriet die Vergabe in den Verdacht der Vetternwirtschaft oder Korruption – manche Abgeordnete hatten Vermittlungsprovisionen erhalten.
Die Problematik in der Maskenaffäre
Vergaberechtlich fragwürdig
Das Verfahren umging klassische Ausschreibungen mit Wettbewerb. Zwar wurde es mit der Pandemie-Notlage begründet, aber:
- Der EuGH (Urteil vom 17. Juni 2021, C-786/19) entschied später, dass ein Open-House-Verfahren doch dem EU-Vergaberecht unterliegt, wenn der Staat Produkte zu festen Bedingungen einkauft.
- Das BMG hätte daher möglicherweise ein transparentes, diskriminierungsfreies Verfahren mit Veröffentlichung im EU-Amtsblatt durchführen müssen.
- Folge: Das Vorgehen hätte eigentlich nicht „außerhalb“ des Vergaberechts stattfinden dürfen.
Vertragsflut & Kontrollverlust
Durch die offene Struktur des Verfahrens:
- schlossen sich mehrere hundert Anbieter gleichzeitig an
- das Ministerium verlor den Überblick über Qualität, Lieferfähigkeit und Seriosität der Vertragspartner
- viele Anbieter waren unerfahren, hatten keine Lieferketten, boten minderwertige Ware oder kamen nicht rechtzeitig
Die Folge war ein massives administratives Chaos.
Mangelhafte oder nicht gelieferte Masken
- Unzureichende Qualitätskontrollen führten dazu, dass unzertifizierte oder mangelhafte Masken geliefert wurden.
- Viele Unternehmen konnten ihre Zusagen nicht erfüllen, lieferten nicht fristgerecht oder gar nicht.
- Es gab keine Sicherheiten oder Bonitätsprüfungen, um Risiken abzusichern.
Ergebnis: Der Staat zahlte oft nicht, oder es kam zu Rückforderungen – die zu tausenden Gerichtsverfahren führten.
Tausende Klagen & Millionenforderungen
- Über 100 Unternehmen verklagten das Gesundheitsministerium, weil dieses nicht oder nur teilweise gezahlt hatte.
- Teils ging es um Millionenbeträge.
- Viele Kläger bekamen Recht, weil die Verträge formal gültig waren – auch wenn sie schlecht vorbereitet waren.
Das Verfahren wurde zu einem teuren juristischen und finanziellen Desaster.
Skandale & politische Verbindungen
- Einige Masken-Deals wurden durch politische Vermittler (u. a. Bundestagsabgeordnete) eingefädelt.
- Es gab Provisionen in Millionenhöhe für Maskenvermittler, teils ohne klare Leistung.
- Die „Maskenaffäre“ führte zu mehreren politischen Rücktritten und Ermittlungen wegen Korruption.
Das beschädigte das Vertrauen in die Integrität der Politik.
Wirtschaftlich ineffizient
- Der Festpreis (z. B. 4,50 € für FFP2-Masken) lag deutlich über Marktpreisen, sobald sich der Markt beruhigte.
- Da kein Preiswettbewerb stattfand, zahlte der Staat überhöhte Preise – auch an Anbieter mit zweifelhafter Qualität.
Ein Open-House-Verfahren verhindert Preisoptimierung.
Zusammenfassung: Was lief schief?
| Bereich | Problem |
|---|---|
| Vergaberecht | Nicht EU-konform, da keine echte Ausschreibung |
| Vertragsmanagement | Massenhafte Verträge ohne Risikoprüfung oder Kontrolle |
| Qualitätssicherung | Mangelhafte oder fehlende Produkte, keine Prüfung |
| Wirtschaftlichkeit | Überhöhte Festpreise, kein Wettbewerb |
| Rechtliche Folgen | Tausende Klagen, millionenschwere Zahlungsverpflichtungen |
| Politische Integrität | Skandale um Abgeordneten-Provisionen |
Hier ein Link zu einem Interview mit Alexander S. Kekulé zumThema